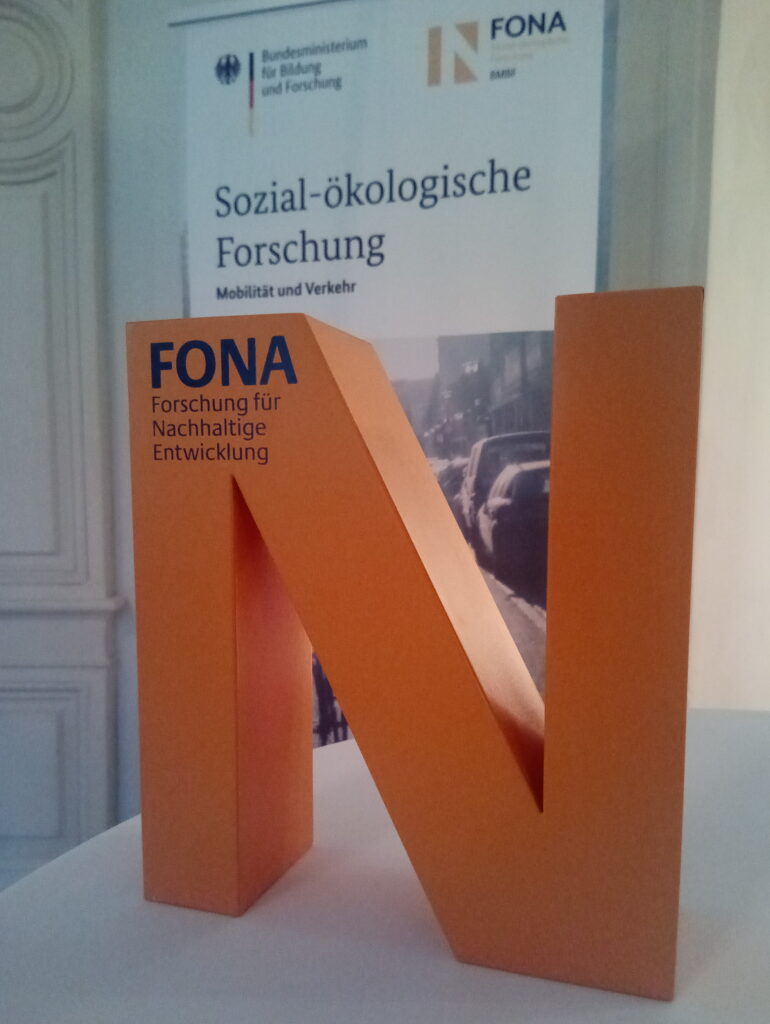In diesem Beitrag in der Zeitschrift für Politikwissenschaft gehen Bastian Rottinghaus und Tobias Escher der Frage nach, wer sich an digitalen Beteiligungsformaten zu lokaler mobilitätsbezogener Planung (nicht) beteiligt und inwieweit personalisierte Einladung zu einer Mobilisierung einer größeren und diverseren Gruppe von Teilnehmenden beitragen kann.
Zusammenfassung
Die sich immer wieder bestätigenden Erkenntnisse über ungleiche politische Beteiligung haben verschiedene demokratische Innovationen motiviert, darunter auch solche, die die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien für politische Online-Beteiligung nutzen. Während die bisherige Forschung nur ein begrenztes Mobilisierungspotenzial digitaler Medien festgestellt hat, fehlt uns noch immer ein gutes Verständnis der Mechanismen, die Bürger*innen dazu bringen, sich für oder gegen eine Online-Beteiligung zu entscheiden. Daher untersuchen wir, wer an den Möglichkeiten zur politischen Online-Beteiligung teilnimmt, was das (Nicht-)Engagement erklärt und wie effektiv personalisierte Einladungen darin sind, die Beteiligung zu erhöhen und zu diversifizieren. Um diese Fragen zu beantworten, haben wir eine vergleichende Studie zu drei fast identischen Verfahren lokaler Online-Beteiligung durchgeführt und uns dabei auf Daten aus Umfragen unter registrierten Nutzer*innen und Stichproben der lokalen Bevölkerung gestützt.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Engagement in der Online-Beteiligung tatsächlich signifikant von der Bevölkerung in Richtung ressourcenstarker Personen verzerrt wird, die sich auch in ihrer Bewertung des Beteiligungsprozesses und seiner Ergebnisse unterscheiden. Dies gilt trotz der Tatsache, dass das Wissen über diese Beteiligungsmöglichkeiten in allen sozialen Gruppen gleich verteilt ist. Während die Ablehnung digitaler Beteiligung für einige ein Hindernis darstellt, sind Misstrauen in den Beteiligungsprozess und mangelndes Interesse stärkere Gründe, sich nicht zu beteiligen. Anhand eines randomisiert-kontrollierten Feldexperiments können wir bestätigen, dass personalisierte Einladungen ein wirksames Mobilisierungsinstrument sind, das die Beteiligung um das Vier- bis Siebenfache erhöht und in begrenztem Umfang auch unterrepräsentierte Gruppen zur Teilnahme bewegen kann. Diese Ergebnisse haben eine Reihe wichtiger Implikationen für Forscher und Praktiker, die die Gleichheit in der politischen Beteiligung erhöhen wollen.
Wesentliche Ergebnisse
- Insgesamt wurden im Jahr 2017 weitgehend identische Online-Partizipationsverfahren in drei Städten in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und untersucht. In Bonn, Köln-Ehrenfeld und Moers war die Bevölkerung aufgerufen, auf einer Online-Plattform Vorschläge zu Verbesserungsmöglichkeiten im Radverkehr abzugeben.
- Zunächst ergeben sich die üblichen Partizipationsmuster mit einer überdurchschnittlich hohen Beteiligung von Männern mit hoher Bildung und mittleren Alters. Ein wesentliches Motiv zur Beteiligung war die Unzufriedenheit mit der Radinfrastruktur.
- Mangelndes Wissen über den Beteiligungsprozess ist der Hauptgrund, sich nicht zu beteiligen. Dabei zeigt sich, dass alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen über den Prozess informiert waren, sich am Ende aber ressourcenstarke Gruppen deutlich häufiger für die Teilnahme entscheiden. Weiterhin bestehen zum Teil spezifische Vorbehalte gegenüber dem Online-Format, die ein Beteiligungshindernis darstellen.
- Im Rahmen eines kontrollierten Feldexperiments wurden an eine zufällige Auswahl von Bürger*innen personalisierte Briefe mit einer Einladung zum Partizipationsverfahren verschickt. Es zeigt sich, dass dadurch die Beteiligung um das vier- bis siebenfache erhöht werden konnte.
- Durch diese Einladung werden auch zusätzliche Gruppen mobilisiert, die ansonsten im Konsultationsverfahren unterrepräsentiert sind. Das betrifft z.B. Frauen und Personen mit geringerer formaler Bildung. Diese weisen zudem etwas andere Einstellungen auf als „die üblichen Verdächtigen“, indem sie etwas weniger kritisch mit der bestehenden Verkehrsinfrastruktur sind, dafür aber den Beteiligungsergebnissen weniger positiv gegenüberstehen .
- Insgesamt zeigt sich damit, dass persönliche Einladungen ein wichtiges Mittel sind, um eine größere und diverse Gruppe von Bürger*innen zur Beteiligung an Konsultationsverfahren zu mobilisieren, die aber die grundsätzliche Unterrepräsentation von Menschen mit geringeren Ressourcen und politischem Interesse nicht beseitigen kann.
Publikation
Rottinghaus, B., & Escher, T. (2020). Mechanisms for inclusion and exclusion through digital political participation: Evidence from a comparative study of online consultations in three German cities. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 30(2), 261–298. https://doi.org/10.1007/s41358-020-00222-7